Für die Betreiber einer Website ist die Bereitstellung eines Impressums rechtlich verpflichtend. Weitere Pflichtseiten kommen für alle hinzu, die Waren oder Dienstleistungen im Onlineshop verkaufen.

Wer Waren oder Dienstleistungen über das Internet anbietet, bewegt sich in einem rechtlich streng regulierten Umfeld. Besonders wichtig für die rechtliche Absicherung sind neben dem Datenschutz diese drei Bestandteile:
- Impressum
- Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
- Widerrufsrecht
Für Impressum, AGB und Widerruf gibt es gesetzliche Vorgaben. Fehler oder Lücken können zu Abmahnungen führen.
Das Impressum
Ein Impressum ist für alle geschäftsmäßigen Webseiten und Online-Shops verpflichtend. Die Grundlage bildet § 5 des Digitale-Dienste-Gesetzes (DGG), dem Nachfolger des Telemediengesetzes (TMG). Es dient der Transparenz und ermöglicht es Kunden, Behörden oder Wettbewerbern, den Anbieter bei Bedarf kontaktieren zu können.
Pflichtangaben im Impressum:
- Name und vollständige Anschrift des Unternehmens
- Vertretungsberechtigte Person (z. B. Geschäftsführer)
- Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse)
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (sofern vorhanden)
Pflichtangaben für bestimmte Onlineshops, je nach Anbieter,Warensortiment oder Dienstleistung
- Nennung einer zuständigen Aufsichtsbehörde.
- Nennung von Registereintragungen, z.B. Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister, Genossenschaftsregister. Nennung von Registernummer und Registerstelle.
- Bei reglementierten Berufen: Nennung einer Kammer und Berufsbezeichnung, Nennung des Staates, in dem die Berufsbezeichnung verliehen wurde. Nennung berufsrechtlicher Regelungen und Informationen über die Zugänglichkeit dieser Regelungen. Betroffen sind hier zum Beispiel Ärztinnen, Apotheker, Archtitektinnen und Anwälte.
- Nennung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach §§ 27a UStG oder Wirtschafts-Identifikationsnummer nach §§ 139c AO.
- Angaben nach §§ 2,3 DL-InfoV bei Dienstleistungen.
- Bei journalistisch-redaktionellen Inhalten auf der Website: Nennung eines Verantwortlichen nach § 18 MstV (Medienstaatsvertrag). Der § 18 MstV löst den ehemaligen § 55 Abs. 2 RstV (Rundfunkstaatsvertrag) ab. Der § 18 MstV gilt auch, wenn der redaktionell Verantwortliche identisch ist mit dem Website-Betreiber ist.
- Achtung: Die Schwelle ist sehr niedrig gesetzt. Ein Blog fällt in der Regel schon unter den Medienstaatsvertrag.
Wie das Impressum platziert werden muss
Das Impressum muss leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein – also mit maximal zwei Klicks auffindbar, idealerweise über einen Link im Footer der Website.
AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nicht gesetzlich vorgeschrieben, jedoch äußerst sinnvoll. Sie regeln die Rahmenbedingungen eines Vertrags zwischen Händler und Kunde und schaffen Rechtsklarheit für beide Seiten.
Typische Inhalte von AGB:
- Geltungsbereich der Bedingungen. Beispiel: „Zwischen der XY-Shop-GmbH und dem Besteller“.
- Vertragsschluss und Bestellvorgang. Beispiel für eine AGB-Klausel zum Zustandekommen eines Kaufvertrags:
„Die Bestellbestätigung stellt keine Annahme Ihres Angebots dar, sondern soll Sie nur darüber informieren, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. Der Kaufvertrag kommt erst mit dem Versand des bestellten Produktes zustande“ - Eigentumsvorbehalt: Der Eigentumsvorbehalt ist eine Vereinbarung im Kaufvertrag, die besagt, dass das Eigentum an einer Sache erst mit vollständiger Bezahlung des Kaufpreises auf den Käufer übergeht. Bis dahin bleibt die Ware im Eigentum des Verkäufers. Der Eigentumsvorbehalt schützt den Verkäufer vor Verlust seines Eigentums, solange er die Gegenleistung (den Kaufpreis) noch nicht bekommen hat.
- Lieferzeiten, Teillieferungen, Versandkosten.
- Haftungsregelungen – unter Wahrung der Regelungen des BGB.
- Achtung: Widerrufsrecht und Datenschutz sind in der Regel nicht in den AGB, sonder auf eigenen Seiten geregelt.
Wichtig:
- AGB dürfen keine überraschenden oder unzulässigen Klauseln enthalten (§ 305 ff. BGB).
- Sie dürfen gesetzliche Verbraucherrechte nicht einschränken.
- Sie müssen vor Vertragsabschluss einsehbar und aktiv akzeptiert werden (z. B. über Checkbox im Checkout-Prozess).
Viele Händler greifen auf juristische Dienstleister oder AGB-Generatoren zurück. Beispiel: Händlerbund.
Widerrufsrecht – Schutz des Verbrauchers im Fernabsatz
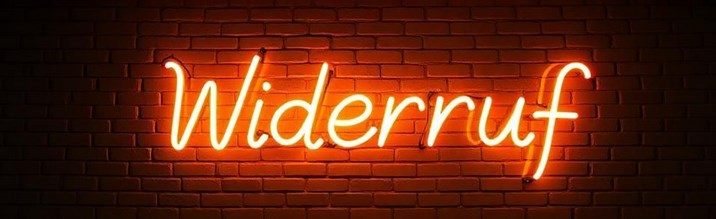
Das Widerrufsrecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert, und zwar im § 355 BGB. Verbraucher in der EU haben bei Onlinekäufen ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. Dieses erlaubt es, einen Kaufvertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen und die Ware zurückzugeben.
Zu trennen ist das Widerrufsrecht von der Gewährleistung und der Garantie!
Exkurs zur Gewährleistung:
Grundlage:
Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Sachmängelhaftung, die im Kaufrecht verankert ist. Dauer:
Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre ab Übergabe der Ware.
Ansprüche des Käufers aus der Gewährleistung sind zum Beispiel:
- Nacherfüllung: Der Käufer kann vom Verkäufer verlangen, den Mangel zu beheben, entweder durch Reparatur oder Ersatzlieferung (Nacherfüllung).
- Minderung: Wenn die Nacherfüllung nicht möglich ist oder erfolglos bleibt, kann der Käufer den Kaufpreis mindern.
- Rücktritt vom Vertrag: Bei erheblichen Mängeln kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten und den Kaufpreis zurückverlangen.
Exkurs zur Garantie
Der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie.
Zurück zum Widerruf:
Pflicht-Bestandteile auf der Website des Händlers:
- Widerrufsbelehrung – dauerhaft zugänglich
- Widerrufsformular – dauerhaft zugänglich
Kundenpflichten im Zusammenhang mit dem Widerrufsrecht:
- Willenserklärung: Der Kunde muss, unter Einhaltung der 14-Tage-Frist, ausdrücklich erklären, den Kaufvertrag rückgängig zu machen.
- Sonderfall Annahmeverweigerung: Das Nichtannehmen einer Ware, zum Beispiel durch die Verweigerung an der Haustüre, stellt für sich alleine noch keinen wirksamen Widerruf dar! Falls der Kaufvertrag weiterhin bestehen bleibt, gerät der Kunde dadurch lediglich in einen Annahmeverzug!
In diesem Fall kann der Händler sein Recht auf Rücktritt vom Vertrag geltend machen oder gegebenenfalls Schadenersatz fordern!
Händlerpflichten im Zusammenhang mit dem Widerrufsrecht:
- Klare Widerrufsbelehrung: Der Kinde muss vor der Abgabe seiner Bestellung über sein Widerrufsrecht informiert werden. Zu Beispiel per Checkbox. Der Text der Widerrufsbelehrung ist auf der Website dauerhaft zu platzieren, gut erreichbar über einen Link, und sollte zudem als E-Mail-Anhang in der Bestellbestätigung versendet werden.
- Widerrufsformular: Händler müssen ein solches Formular bereitstellen, das der Kunde verwenden kann – aber nicht muss.
- Der Kunde kann auch per Email, Fax, Brief oder Telefon widerrufen!
- Erstattungspflicht: Nach Eingang des Widerrufs muss der Händler innerhalb von 14 Tagen den vollen Kaufbetrag inkl. Standardversand erstatten.
- Bei der Ausgestaltung von Widerufsbelehrung und Formular setzt der Gesetzgeber enge Grenzen! Die Vorlage ist im EGBGB verankert: Widerruf.
Versandkosten beim Widerruf
- Hinsendekosten vom Verbraucher zurück zum Verkäufer: Der Verkäufer muss dem Kunden die Kosten erstatten. Hinsendekosten sind Kosten, die der Kunde zusätzlich zum Kaufpreis zahlen muss. Der Verkäufer muss diese Kosten aber nur in der von seinem Shop angebotenen, günstigsten Standardlieferung erstatten. Die Zusatzkosten für eine teure Express-Lieferung muss der Verkäufer nicht erstatten.
- Rücksendekosten: Der Händler könnte per AGB festlegen, dass der Kunde die Kosten der Rücksendung trägt – das kann allerdings zu negativen Bewertungen führen. Aus Gründen der Werbung übernehmen die meisten Onlinehändler die Rücksendekosten.
Ausnahmen vom Widerrufsrecht:
- Versiegelte Waren aus Hygienegründen (z. B. Kosmetik, Unterwäsche)
- Maßgeschneiderte oder personalisierte Artikel
- Zeitungen, Zeitschriften oder schnell verderbliche Waren
- Dienstleistungen
Widerrufsrecht bei Teillieferungen
- Die Widerrufsfrist beginnt mit dem Erhalt der Ware.
- Falls die Ware in mehreren Teilsendungen geliefert wird, beginnt die Frist mit dem Erhalt der letzten Ware!
- Wird die Ware regelmäßig über einen festgelegten Zeitraum geliefert (Abonnement), beginnt die Widerrufsfrist mit dem Erhalt der ersten Ware.
Die Belehrung über das Widerrufsrecht muss verständlich, vollständig und gut sichtbar sein. Fehlerhafte oder fehlende Angaben führen dazu, dass die Widerrufsfrist nicht zu laufen beginnt – in der Praxis kann das zu Widerrufsrechten von bis zu 12 Monaten plus 14 Tagen führen.
Rechtliche Risiken bei Fehlern
Unvollständige oder fehlerhafte Angaben im Impressum, in den AGB oder beim Widerrufsrecht gehören zu den häufigsten Abmahngründen im E-Commerce. Abmahnungen können nicht nur finanzielle Schäden verursachen, sondern auch das Vertrauen der Kunden beschädigen.
Typische Fehlerquellen:
- Veraltete Mustertexte aus dem Internet
- Keine Anpassung an das eigene Geschäftsmodell
- Fehlende oder schwer auffindbare Widerrufsbelehrung
- Nicht rechtssichere AGB-Klauseln
Best Practices für Onlinehändler
- Verwende geprüfte Texte: Nutze AGB und Widerrufsbelehrungen von seriösen Anbietern oder spezialisierten Kanzleien.
- Halte alles aktuell: Rechtliche Vorgaben ändern sich regelmäßig – bleibe auf dem Laufenden.
- Sorge für Sichtbarkeit: Verlinke Impressum, Datenschutz, AGB und Widerrufsrecht im Footer.
- Dokumentiere Zustimmungen: Lass AGB und Widerrufsrecht aktiv durch eine Checkbox bestätigen – das schafft Rechtssicherheit.
Fazit
Impressum, AGB und Widerrufsrecht gehören zu den juristisch relevanten Bausteinen jedes Onlineshops. Wer diese drei Bestandteile rechtskonform umsetzt, schützt sich vor Abmahnungen und Bußgeldern..