Was früher der Versandkatalog war, ist heute der Onlineshop. Aus dem Otto- und dem Quellekatalog wurde der E-Commerce.
E-Commerce – kurz für Electronic Commerce – bezeichnet den elektronischen Handel mit Waren und Dienstleistungen über das Internet.
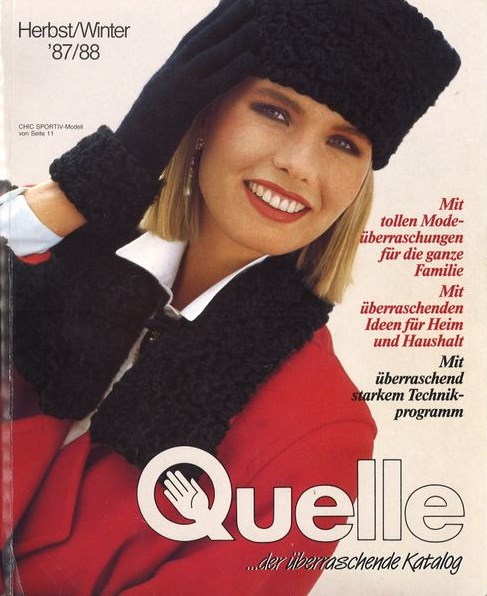
Vom klassischen Fernhandel zum modernen E-Commerce
Im 20. Jahrhundert war der Fernhandel vor allem durch Katalogbestellungen und Telefonate geprägt. Kunden konnten bequem von zu Hause aus Produkte bestellen, ohne in ein Geschäft gehen zu müssen. Diese Art des Einkaufens bot Komfort und eine große Auswahl. Doch der Quelle-Katalog, das in Deutschland meistgelesene Buch des 20. Jahrhunderts, wird nicht mehr gedruckt. Heute wird nicht mehr im Katalog geblättert, es wird online bestellt.
Die Amazon-Story
Das Unternehmen Amazon.com, Inc. wurde 1994 vom US-amerikanischen UnternehmerJeff Bezos (*1964) gegründet. Heute beschäftigt Amazon weltweit etwa 88.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Alternativen zu Amazon
Das Unternehmen dominierte lange den Onlinemarkt, doch der E-Commerce jenseits von Amazon ist am Wachsen. In Europa steigern Etsy, OnBuy, Wayfair UK und Temu ihre Umsätze – aber auch unabhängige Onlineshops wie Thomann, Mediamarkt oder Tschibo sind Alternativen zu Amazon. Kleinere Onlineshops, zum Beispiel für Bücher, Brettspiele und Fair-Trade-Mode sind auf rabatte.shop gelistet.
Die Vorteile des E-Commerce
- Für Unternehmen jeder Größe bietet der E-Commerce eine Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen.
- Für den stationären Handel, den „Laden ums Eck“, sichert der E-Commerce bei steigenden Mieten die Existenz. Der Onlinehandel zerstört nicht das Ladengeschäft, er trägt zum Überleben bei!
- Dienstleister (Ärzte, Therapeuten, Nachhilfeanbieter, Musiklehrer, Friseure, Yogastudios …) schließen via E-Commerce Verträge und wickeln Zahlungen ab. Und zwar, bevor der Kunde die Leistungen in Anspruch nimmt.
Was Shopbetreiber benötigen:
- Fachwissen über Geschäftsmodelle.
- Auswahl des geeigneten Shopsystems.
- Management von Logistik und Fulfillment.
- Kenntnis der rechtlichen Bestimmungen.
Geschäftsmodelle im E-Commerce
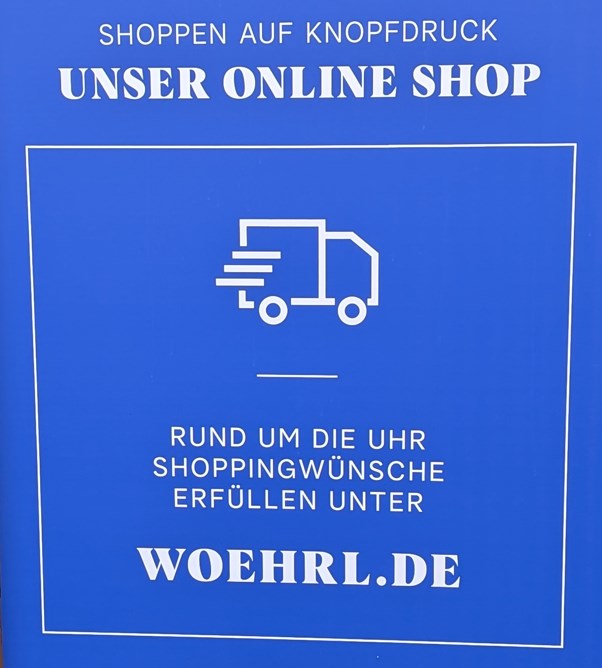
E-Commerce umfasst geschäftliche Transaktionen, die online stattfinden, also via Email, Onlineshop, Marktplatz oder App. Je nach Beteiligten kann der E-Commerce in folgende Kategorien unterteilt werden:
- B2C (Business-to-Consumer): Unternehmen verkaufen direkt an Verbraucher.
- B2B (Business-to-Business): Handel zwischen Unternehmen.
- C2C (Consumer-to-Consumer): Handel zwischen Privatpersonen, z. B. über Marktplätze wie eBay oder kleinanzeigen.de
- D2C (Direct-to-Consumer): Hersteller verkaufen direkt an Verbraucher.
Eine Liste von Produkten, die sich im E-Commerce verkaufen lassen:
Geschäftsmodelle-Übersicht
Auswahl des Shopsystems
Ein großer Teil des B2C-Handels findet über Onlineshops statt. Für den Betrieb eines Onlineshops ist ein Shopsystem nötig. Drei populäre Shopsysteme sind:
- WooCommerce – kostenloses Shop-Plugin für WordPress.
- Shopify – eigenständiges Shopsystem. Kosten: ab 33 € pro Monat.
- Shopware – eigenständiges Shopsystem. Kosten: ab 199 € pro Monat.
Neben der Shop-Software sind weitere technische Voraussetzungen notwendig:
- Domain: Eine eigene Webadresse wird auch als Domain bezeichnet. Zur Verfügung gestellt wird die Domain, wie auch der zugehörige Webspace, von einem Hoster. Große Unternehmen verfügen über eigene Server. Amazon geht noch einen Schritt weiter und ist mit AWS (Amazon Webservice) auch Server-Anbieter für andere Unternehmen.
- Zahlungssysteme: Weit verbreitete Zahlungsmethoden sind zum PayPal, Kreditkarte, Klarna und Apple Pay. Neu auf dem Markt ist wero, die europäische Alternative zu PayPal.
- Buchhaltung und Warenwirtschaft: Je nach Shopsystem sind Funktionen für Buchhaltung und Warenwirtschaft bereits integriert oder müssen über eine Schnittstelle angebunden werden.
Logistik & Fulfillment
Ein unverzichbarer Bestandteil des E-Commerce ist die Logistik. Kunden erwarten eine schnelle, sichere und transparente Lieferung. Zu den Aufgaben von Shopbetreibern gehören :
- Lagerhaltung: Eigene Lager oder Outsourcing an Fulfillment-Dienstleister. Ein Fulfillment-Dienstleister übernimmt Teile oder auch die gesamte Logistik für E-Commerce-Unternehmen, zum Beispiel Lagerung, Kommissionierung, Verpackung, Versand und Retourenmanagement. Durch das Auslagern (Outsourcing) dieser Aufgaben können sich Händler auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.
- Zusammenarbeit mit Versandpartnern: Kooperation mit Versanddienstleistern wie DHL, UPS oder Hermes.
- Click and Collect: Auslieferung von Produkten an Filialen. Beispiel: Tschibo.
- Retourenmanagement: Organisation der Rücksendungen und Rückerstattungen.
Rechtliche Bestimmungen für den E-Commerce
Onlinehändler müssen zahlreiche gesetzliche Vorschriften beachten:
- Impressumspflicht: Transparente Angaben zum Unternehmen. Empfehlenswert ist eine separate Impressumsseite.
- Datenschutz (DSGVO): Umgang mit personenbezogenen Daten (wozu auch die IP-Adresse zählt, also die Einwahlnummer ins Internet).
- Widerrufsrecht: Kunden im EU-Raum steht bei Onlinekäufen ein Widerrufsrecht von 14 Tagen zu. Das Widerrufsrecht kann der Kunde unabhängig vom Gewährleistungsrecht in Anspruch nehmen.
- Informationspflichten: Klare und vollständige Produktbeschreibungen und Preisangaben. Versandkosten und Lieferzeiten müssen angegeben werden.
- AGB: Keine Pflichtangabe, aber trotzdem empfehlenswert, um beispielsweise Unklarheiten zum Zeitpunkt des Vertragsabschluss zu vermeiden
In gängigen Shopsystemen wie WooCommerce, Shopify oder Shopware sind für die Pflichtinformationen entsprechende Seiten vorgesehen und in den Bestellprozess eingebunden, zum Beispiel durch eine Checkbox „Ich habe die AGB gelesen“.
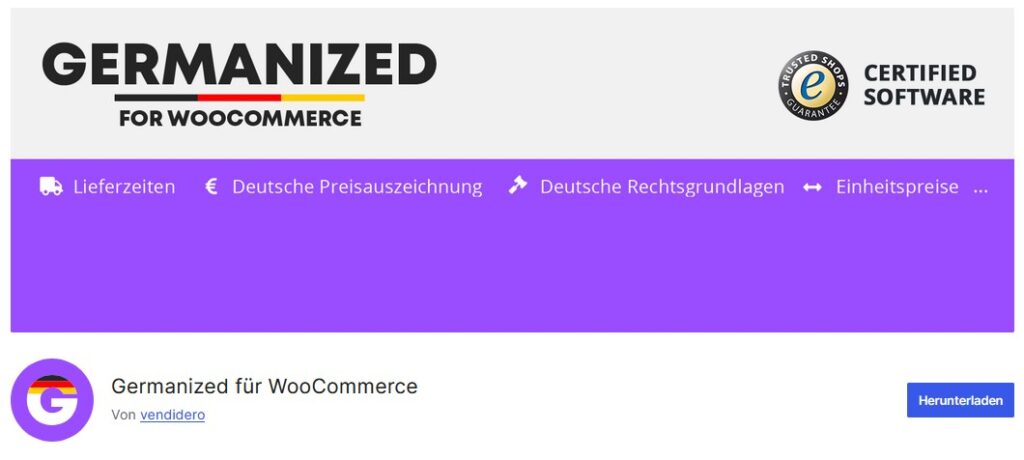
Achtung: Für WooCommerce ist dazu ein Eindeutschungs-Addon wie German Market oder Germanized notwendig.
Aufgaben zu Lektion 1
- Das Plugin WooCommerce installieren
- Ein Produkt anlegen
- Produktbild und Produktgalerie anlegen
- Produktbeschreibungen (lang und kurz) anlegen
- Ein Bild in die Produktbeschreibung einfügen
- Einen Preis hinzufügen
- Produktkategorien anlegen und Produkten zuweisen
- Das Shoptheme Storefront installieren und aktivieren
- Ein Maintenance-Plugin installieren und den Wartungsmodus aktivieren
Weitere Aufgaben:
- Newsletter gestalten
- Social Media Posts kreieren
- Blogartikel verfassen
Links
- Talk mit Ellen Bauer über Blockthemes und WooCommerce (engl)


